Im aktuellen Zeitmagazin gibt es einen Bericht über Ahmad Mansour1, einem in Deutschland lebenden palästinensischem Israeli, der als Psychologe mit seinen Ansichten über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas sehr polarisiert. Solche komplexen Geschichten gibt es in diesem Konflikt zuhauf.
Einen Kommentar über den Konflikt zu schreiben gleicht einem Tanz auf der Nadelspitze, zum einen weil er so emotionalisiert ist und zum anderen weil er auf Deutsch geschrieben wird. Das kommt nicht etwa daher, „weil man ja nicht mehr seine Meinung sagen kann“ wie angesichts des Themas nicht nur AfD Anhänger jetzt rufen werden. Es kommt daher, weil wir Deutschen eine historische Verantwortung für dieses tragische Dilemma haben. Trotzdem will ich eine Stellungnahme versuchen, basierend auf dem, was ich darüber weiß.
Der Kommentar ist etwas länger als gewohnt, hoffentlich trotzdem lesenswert
Ein “Volk ohne Raum“, wenn dieser mit der Ideologie des Nationalsozialismus verbundene Roman Titel des völkischen Schriftstellers Hans Grimm2 für ein Volk lange Zeit reale Bedeutung hatte, dann für das jüdische Volk. Dass das jüdische Volk alle Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung überlebt hat, liegt an einer einzigartigen Verknüpfung von Religion und Identität.
Diese Verknüpfung ist gleichsam Fluch und Segen. Fluch, weil es Angehörige dieses Volkes identifizierbar macht, als Projektionsfläche für jede Form von Hass und Ausgrenzung. Segen, weil es zu einem einzigartigen Zusammenhalt über den örtlichen Raum hinaus führte. Jüdische Gemeinden waren in ganz Europa verteilt, später auch auf der ganzen Welt. Sie mussten lange Zeit ohne einen Raum überleben, abgesehen vom Sehnsuchtsort Jerusalem. Ihnen wurden Räume zugewiesen, unter manchmal mehr als menschenunwürdigen Bedingungen.
Der Sehnsuchtsort der jüdischen Bevölkerung ist aber ein Ort höchster Bedeutung für drei Weltreligionen, immer wieder in kriegerischen Konflikten umkämpft. Die jüdische Welt hat vielleicht die historisch ältesten Rechte, musste sie aber früh aufgeben. Dieser Ort kann – so glaube ich – nur noch friedlich geteilt sein, das er heute zerteilt ist, ist das Ergebnis eines wohl unlösbaren Dilemmas.
Unabhängig war diese Region um den Sehnsuchtsort Jerusalem die meiste Zeit nicht, seit mehr als 2000 Jahren immer nur eine Provinz, erst eine der Römer, dann lange Zeit arabisch. Da es immer nur Teil eines Staates war, wird den Palästinensern oft abgesprochen, überhaupt ein Volk zu sein. Hier steht die Behauptung im Raum, dass es einen „Raum ohne Volk“ gab. Die Bewohner Palästinas, so die Aussage, seien seit der arabischen Eroberung letztlich Araber, wiederum ein komplizierter Begriff.
Spätestens mit dem Zerfall des osmanischen Reiches wurde die Region aufgeteilt, gehörte zu Syrien und teilweise zu Jordanien ehe es in der Konferenz von San Remo 1920 den Briten als Mandatsgebiet zugerechnet wurde. Nun stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen „Raum ohne Volk“ geben kann. Was ist ein Volk? Sind eine gemeinsame Sprache, Religion, Kultur und ein gemeinsamer Raum, in dem man selbst bestimmt leben kann, Vorbedingungen für eine Identifikation als Volk?
Diese Diskussion stellte sich in Europa schon länger, als der Nationenbegriff nach der französischen Revolution neu und schärfer definiert wurde. Den Palästinensern absprechen zu wollen, ein Volk zu sein, ist arrogant, wie ich meine. Die europäische Geschichte ist voll von Beispielen, bei denen Räume und deren Bewohner auch ohne eine vollständige Selbstbestimmtheit eine Identität besaßen.
Die Bewegung um Herzl war tief von dieser Selbstbestimmtheit und dem Nationenbegriff beeindruckt und definierte ihn für das jüdische Volk, dem der Ort fehlte, aber eine tiefe Identifikation über die Religion und Kultur besaß. Mit dem Beginn der Einwanderung von jüdischen Bürgern trafen nun Menschen mit einer klaren Vorstellung von Nationen und einem starken Verständnis für die eigene Identität auf Menschen, denen diese Begriffe bislang nichts sagten, nichts sagen konnten, weil ihr Selbstverständnis nicht durch die Diskussionen über den Begriff „Nation“ geprägt war. Gleichzeitig stellte die Etablierung des Mandatsgebiet für die arabischen Nachbarn eine Provokation dar.
Seit 1921 gibt es erste gewaltsame Auseinandersetzungen im Mandatsgebiet zwischen arabischstämmigen und jüdischen Bewohnern des Gebiets. Der arabische Widerstand wird insbesondere in der Zeit von 1936-39 intensiver. Die Briten sind uneins, wie mit der Situation umzugehen ist, vorfallen, weil sich der Widerstand beider Gruppen auch gegen die britische Anwesenheit in dem Gebiet wendet.
Die von den Briten teilweise geduldete Einwanderung von europäischen Juden bekam mit dem Bekanntwerden der Vernichtung der Juden durch Deutschland eine völlig neue Wendung. Während in der Praxis der Schutz von Juden durch die Alliierten keineswegs reibungslos funktionierte, was die Geschichte der Exodus eindrücklich vor Augen führte, gab es in der UN eine zusehends moralische begründete Unterstützung der jüdischen Einwanderung nach Palästina. Der Historiker Isaac Deutscher gab eine einprägsame Beschreibung des Dilemmas3. Er verglich die Situation in Palästina mit folgender Situation. Ein Mann springt auf der Flucht vor einem Feuer, in dem schon viele seiner Verwandten gestorben sind, aus einem Haus. Dabei fällt er auf einen Passanten, der sich dabei die Beine und Arme bricht. Rational betrachtet, hat keiner der beiden Schuld und beide sollten sich einander zuwenden, um gemeinsam die Folgen des Ereignisses abzumildern. Wenn beide irrational handeln, endet der Konflikt in einer ewigen Schuldzuweisung und Verbitterung.
Die weitere Geschichte des israelischen Staates illustriert diese irrationale Spirale der Gewalt. Und die Welt schaut auch nicht neutral auf dieses Dilemma, weil es den noch immer vorhandenen Antisemitismus in den eigenen Reihen fürchtet oder nicht aufgeben will.
Was hat dieser lange Exkurs nun mit dem Artikel in der Zeit zu tun? Mansour stammt aus einer Familie, die nach der Gründung Israels unter den immer schwierigeren Verhältnissen für die Palästinenser in ihrer Heimatstadt gelitten hat, dessen Großvater in der irakischen Armee 1948 gegen den neugegründete israelischen Staat gekämpft hat. Er wurde als Palästinenser erzogen, im Islam verwurzelt.Dann studiert er in Tel Aviv Psychologie, als einziger Palästinenser in seinem Jahrgang. Nachdem der Terror durch die Intifada ab 2000 immer stärker wurde, beschloss er, nach Deutschland zu gehen. Jetzt wendet er sich gegen energisch gegen die pro-palästinensischen Stimmen und betont die Gräuel des 7.Oktober, die nach seiner Meinung nicht genügend in der Auseinandersetzung mit dem Gaza-Konflikt berücksichtigt werden.
Meine Position zu dem Konflikt habe ich noch nicht gefunden. Für mich stellen sich die folgenden Fragen:
- Führt die israelische Regierung mit angemessenen Mitteln einen Verteidigungskrieg gegen die Hamas, angesichts der Tatsache, dass die Hamas alle völkerrechtlichen Spielregeln missachtet?
- Hat die israelische Regierung das Recht, internationale Absprachen zu brechen, wie in der Siedlungspolitik?
- Ist der im Raum stehende Vorwurf von Antisemitismus bei der Diskussion dieses Krieges generell berechtigt?
Insbesondere die letzte Frage ist schwierig, denn unbestritten steigt die Akzeptanz von antisemitischen Äußerungen und leider auch Taten generell an. Eine Kritik am israelischen Staat ist insbesondere deswegen so schwierig, weil der Staat eine so stark identitätsstiftende Wirkung hat. Obwohl nicht alle israelischen Bürger mit ihrem Staat und der momentanen Regierung einverstanden sind, gibt es die Angst, dass sich in der Kritik grundsätzliche Ablehnung einer jüdischen Identität verbirgt, letztlich also eine Form des Antisemitismus. Die Haltung von Ahmad Mansour kann nach meiner Beurteilung ein Bespiel für diese Sorge sein.
Woher kommt diese Sorge? Ein Grund mag die Problematik der Definition von Antisemitismus sein. Wann ist eine Aussage als antisemitisch zu bewerten? Das IHRA formuliert es auf ihrer Webseite so4:
„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“
Im weiteren Verlauf wird erläutert, wann eine Kritik am israelischen Staat berechtigt ist.
„Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden.“
Diese Definition ist umstritten, insbesondere weil sie so weit gefasst ist, aber Grundlage vieler Staaten, sich für den Kampf gegen Antisemitismus zu engagieren.
Die EU hat dazu eine erweiterte Erklärung erstellt5, um „als Leitfaden für ihre Arbeit (…) von Ländern, Städten, Regierungsinstitutionen, Universitäten, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Sportvereinen (…) als Referenz in Projekten, die darüber aufklären wollen, in welchen Formen sich Antisemitismus zeigt, sowie für Initiativen, die sich auf die Erkennung und Bekämpfung von Erscheinungsformen von Antisemitismus konzentrieren, genutzt [zu werden].“
Der Antisemitismus ist so tief in so vielen Menschen verankert, dass wir als Gesellschaft große Angst vor ihm haben sollten, er ist Ausdruck einer tiefen Menschenverachtung und steht für ähnlich zerstörerische Ansichten wie Rassismus und Hass gegenüber Minderheiten jeglicher Art. Er ist Ausdruck einer tiefen Verachtung den Menschenrechten gegenüber.
Trotzdem muß sich der israelische Staat kritischen Fragen stellen. Ein Verweis auf angeblichen Antisemitismus nach den Haftbefehlen des internationalen Strafgerichtshofes gegen Israel und Hamas oder den Bericht über Apartheid in Israel 2022 sind meiner Meinung nach ungerechtfertigt.
Die dritte Frage oben würde ich also verneinen, generell muss es ohne sich dem Vorwurf von Antisemitismus auszusetzen erlaubt sein, die Handlungsweise der israelischen Armee kritisch zu hinterfragen. Die beiden anderen oben genannten Fragen kann ich für mich noch nicht beantworten, dazu braucht es noch mehr Information und Recherche. Ob man sie generell beantworten kann, bleibt offen.
Teil II:Was geschehen ist
Teil III Gerechter Krieg?
- Artikel im Zeitmagazin: Leider hinter einem Bezahlvorhang https://www.zeit.de/zeit-magazin/2025/20/ahmad-mansour-islamismus-israel-palaestina-migration
↩︎ - Artikel Volk ohne Raum Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Volk_ohne_Raum
↩︎ - Isaac Deutscher Allegorie vom brennenden Haus https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Deutscher?wprov=sfti1
↩︎ - (4) IHRA Definition https://holocaustremembrance.com/resources/arbeitsdefinition-antisemitismus
↩︎ - EU Handbuch zur praktischen Anwendung der IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus https://report-„antisemitism.de/documents/IHRA-Definition_Handbuch.pdf
↩︎
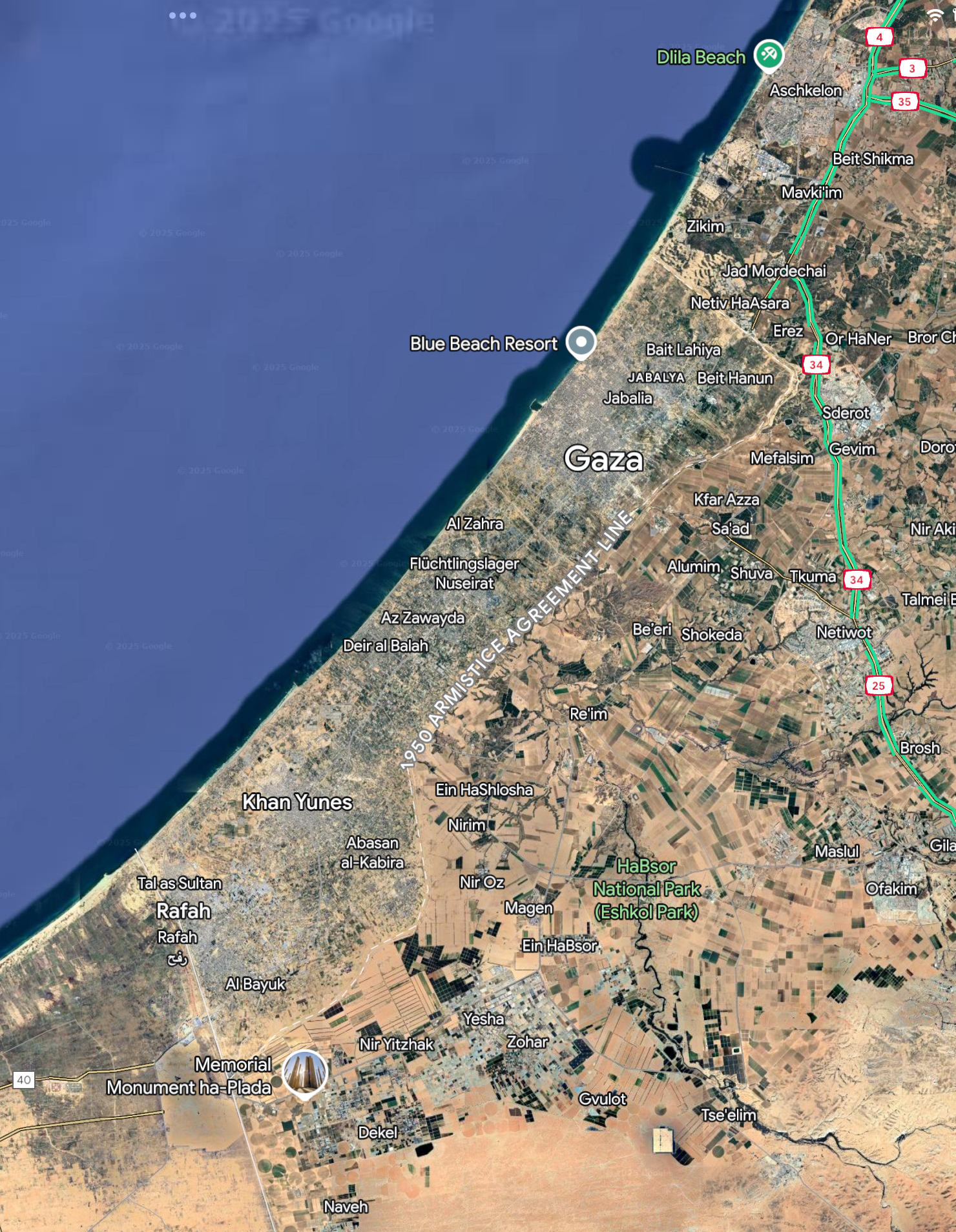
Schreibe einen Kommentar